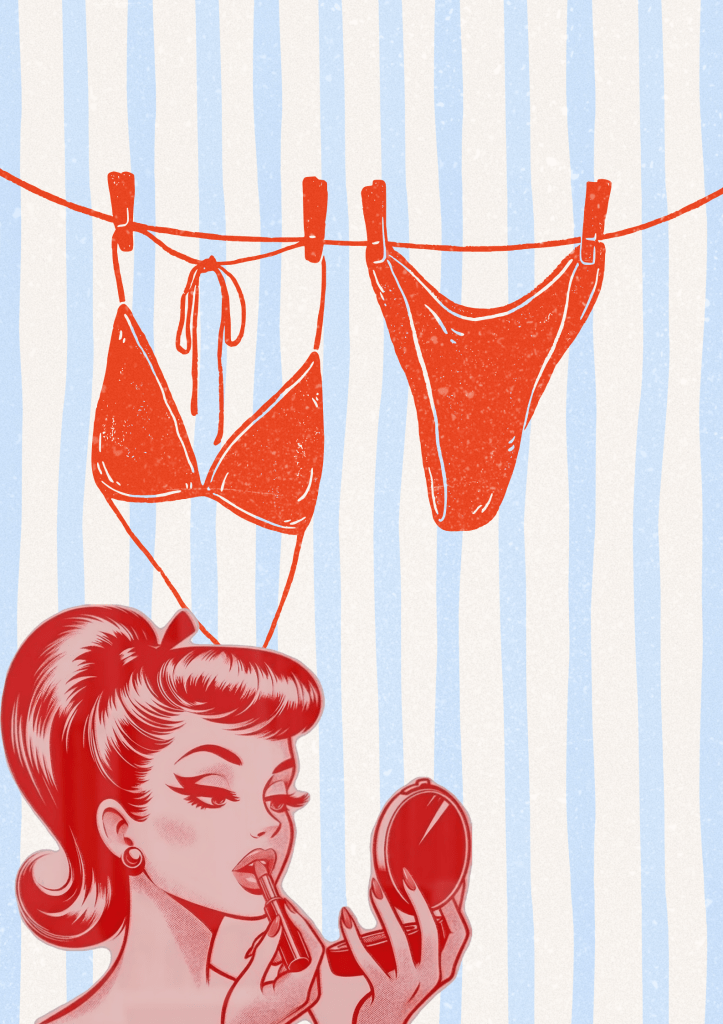
Kapitel 3.1 Good Girl
In den letzten 18 Jahren habe ich viele Männer kennengelernt und noch mehr Erfahrung gesammelt. Seit der Entstehung von Social Media hat sich meine Erfahrung mit Männern nicht gerade zum Besseren entwickelt. Ich habe viel gedatet und gehofft, irgendwann eine glückliche Familie gründen zu können. Was mir damals kein Schwein gesagt hat: Um eine glückliche Familie zu gründen, musst du zuerst selbst glücklich werden. Um eine gleichberechtigte Familienstruktur aufbauen zu können, solltest du das gleiche Bildungsniveau und den gleichen finanziellen Status wie dein Partner haben. Ansonsten wird der Mann häufig versuchen, dich zu dominieren. Stehst du besser da oder bist finanziell unabhängiger, kann er dich schnell als Konkurrenz sehen – und es kann passieren, dass er aggressiver wird, dich abwertet oder versucht, kleinzumachen, weil er damit nicht klarkommt.
Ich selbst wurde früh dazu erzogen, ein „Good Girl“ zu sein. Aber von Natur aus war ich das nie. Schon mit sieben wurde ich einmal aus dem Religionsunterricht geschickt, weil ich einem Priester widersprach, der erklärte, dass Frauen nur dazu geboren seien, dem Mann zu dienen. Ich erwiderte etwas wie: „Dann tut mir leid für ihre Mutter.“ Rückblickend kann ich verstehen, dass der Priester sich beleidigt fühlte – aber ich hatte schon damals dasselbe Gefühl wie heute: Ich würde niemals einfach folgen, nur weil es von mir erwartet wird. Ich bin eher der Typ, der die Führung übernimmt, wenn ich sehe, dass der Partner unsere Beziehung durch die Wand fährt. Ich habe einmal von einer großen Familie geträumt. Ein Mann, vier Kinder, das Leben auf dem Dorf. Die Rollen sollten klar sein: Er verdient das Geld, ich kümmere mich um Haus und Vieh. Keine Fragen, keine Diskussionen. Heute würde ich sagen, ja, das war ziemlich mormonmäßig gedacht – oder zumindest so, wie es sich in großen Profilen wie Ballerina Farm zeigt.
Doch meine Realität sah anders aus, durch die polnischen Männer, mit denen ich aufwuchs. Ich musste schnell lernen, ruhig zu bleiben, mich in jeder Situation zurechtzufinden und mich selbst zu behaupten.
Heute, während ich die Empörung sehe – über Frauen, die zwangssterilisiert wurden, denen Spiralen ohne Wissen eingesetzt wurden –, denke ich mir: Warum tun wir so überrascht? Auch hier in Deutschland gab es das. Nicht vor langer Zeit, nicht nur in anderen Ländern. Ich selbst war eine von den Mädchen, die ohne mein Wissen oder Einverständnis eine Spirale eingesetzt bekam. Und nachdem ich sie in Polen entfernen ließ, wurde ich von meiner deutschen Gynäkologin beschimpft.
Das bringt mich nachdenklich: Wie viele Frauen haben ähnliches erlebt? Nicht nur schwarze Frauen, die von weißen Männern als „Kaninchenobjekte“ missbraucht wurden. Ich spreche auch nicht nur über Polen, wo Abtreibungsrechte Frauenleben kosten können. Ich spreche über Deutschland – ein Land, das sich lange als hochentwickelt und feministischer Vorreiter darstellte – und das trotzdem in vielen Bereichen versagt, wenn es um die Körperrechte und die Autonomie von Frauen geht. Und wenn wir schon bei Frauenkörperrechten sind: Warum versagen wir bei der Anerkennung von Oktober 7? Warum dürfen einige von uns vergewaltigt werden und offiziell mit dem Trauma klarkommen, während andere ausgeschlossen bleiben – wie zum Beispiel israelische Frauen oder Ukrainerinnen? Wir neigen dazu, Ausländerinnen, alles Fremde, zu dämonisieren. Außer den „richtigen“ Dämonen – die nennen wir Männer.
𝓝𝓾𝓻 𝓴𝓾𝓻𝔃 𝔃𝓾𝓻 𝓚𝓵𝓪𝓻𝓼𝓽𝓮𝓵𝓵𝓾𝓷𝓰: 𝓗𝓮𝓾𝓽𝓮 𝓫𝓲𝓷 𝓲𝓬𝓱 𝔀𝓮𝓭𝓮𝓻 𝓹𝓻𝓸 𝓘𝓼𝓻𝓪𝓮𝓵 𝓷𝓸𝓬𝓱 𝓹𝓻𝓸 𝓟𝓪𝓵𝓪̈𝓼𝓽𝓲𝓷𝓪. 𝓘𝓬𝓱 𝓫𝓲𝓷 𝓹𝓻𝓸 𝓯𝓻𝓮𝓲𝓮 𝓑𝓲𝓵𝓭𝓾𝓷𝓰. 𝓓𝓮𝓷𝓷 𝓲𝓬𝓱 𝓰𝓵𝓪𝓾𝓫𝓮, 𝓮𝓼 𝓰𝓲𝓫𝓽 𝓴𝓮𝓲𝓷𝓮 𝓰𝓻𝓸̈𝓼𝓼𝓮𝓻𝓮 𝓖𝓮𝔀𝓪𝓵𝓽 𝓪𝓾𝓯 𝓭𝓮𝓻 𝓔𝓻𝓭𝓮 𝓪𝓵𝓼 𝓯𝓮𝓱𝓵𝓮𝓷𝓭𝓮 𝓑𝓲𝓵𝓭𝓾𝓷𝓰.
Wir produzieren immer mehr Opfer. Wir genießen es, das Leid anderer zu sehen. So wie bei den israelischen Frauen am 7. Oktober oder den Kindern in Somalia, die mit deutlich älteren Männern verheiratet wurden. Nicht, weil sie das unbedingt wollten, sondern weil ihre Familien keinen Zugang zu Bildung hatten – und damit auch keine Möglichkeit, bessere Arbeit oder ein besseres Einkommen zu sichern.
Wir hören davon, dass irgendwo wieder ein Femizid passiert ist – und wir tun so, als wäre es neu. Dabei ist es das nicht. Es ist kein neues Phänomen. Wir sahen das schon in den 50ern. Wir sahen es noch früher. Wir lernten in Geschichtsbüchern, dass, sobald ein Volk ein anderes unterjochen wollte, die ersten Opfer oft Frauen und Kinder waren – sexuell missbraucht oder ermordet. Männliche Gewalt richtet sich häufig gegen Frauen und weibliche Autonomie.
Wir lernten von Hexenverbrennungen – meist Frauen, die als Hebammen gearbeitet hatten oder zu selbstständig waren, Männer nicht brauchten. Und das fragile männliche Ego reagierte: zerstören, was Konkurrenz sein könnte.
Warum passiert das heute noch? Weil wir als Gesellschaft versagen, unsere Männer zu Menschen zu bilden. Wir bilden sie zu gefühllosen Robotern aus, zu Zombies, die keine Emotionen zeigen dürfen. „Heul nicht wie ein Weib. Sei nicht weich. Sei kein Pussy.“ Wir erziehen den Minimenschen dazu, dass Emotionen oder Interessen, die nicht männlich „passen“, falsch sind – Autos statt Puppen, Stärke statt Sensibilität.
Und dennoch nennen wir uns modern. Doch in so vielen Männern steckt noch immer der abgefärbte Code älterer Generationen – gerade bei denen, die Macht und Geld besitzen. Sie träumen davon, dass alles wieder wie früher wird: die Frau zurück in die Küche, ohne Rechte, die Kinder behütend, bloß kein Wort sagen. Dass sie dabei vergessen, dass Frauen häufig unter Druck oder sogar unter Drogen gesetzt wurden.
𝓚𝓾𝓻𝔃: 𝓘𝓷 𝓢𝓸𝓶𝓪𝓵𝓲𝓪 𝓼𝓽𝓻𝓮𝓲𝓴𝓮𝓷 𝓾𝓷𝓭 𝓹𝓻𝓸𝓽𝓮𝓼𝓽𝓲𝓮𝓻𝓮𝓷 𝓜𝓪̈𝓷𝓷𝓮𝓻, 𝔀𝓮𝓲𝓵 𝓼𝓲𝓮 𝓳𝓮𝓽𝔃𝓽 𝓹𝓮𝓻 𝓖𝓮𝓼𝓮𝓽𝔃 𝓴𝓮𝓲𝓷𝓮 𝓚𝓲𝓷𝓭𝓮𝓻 𝓶𝓮𝓱𝓻 𝓱𝓮𝓲𝓻𝓪𝓽𝓮𝓷 𝓭𝓾̈𝓻𝓯𝓮𝓷. 𝓘𝓷 𝓪𝓷𝓭𝓮𝓻𝓮𝓷 𝓣𝓮𝓲𝓵𝓮𝓷 𝓭𝓮𝓻 𝓦𝓮𝓵𝓽, 𝔀𝓲𝓮 𝓟𝓸𝓵𝓮𝓷, 𝓼𝓬𝓱𝓻𝓮𝓲𝓫𝓮𝓷 𝓜𝓪̈𝓷𝓷𝓮𝓻 𝓪𝓾𝓯 𝓶𝓪̈𝓷𝓷𝓵𝓲𝓬𝓱𝓮𝓷 𝓕𝓸𝓻𝓮𝓷: „𝓢𝓲𝓮 𝔀𝓪𝓻 15, 𝓭𝓪𝓼 𝔀𝓪𝓻 𝓼𝓸 𝓰𝓮𝓷𝓲𝓪𝓵, 𝓲𝓬𝓱 𝓱𝓪𝓫𝓮 𝓲𝓱𝓻 𝓐𝓵𝓴𝓸𝓱𝓸𝓵 𝓰𝓮𝓰𝓮𝓫𝓮𝓷.“ 𝓤𝓷𝓭 200 𝓪𝓷𝓭𝓮𝓻𝓮 𝓜𝓪̈𝓷𝓷𝓮𝓻 𝓴𝓸𝓶𝓶𝓮𝓷𝓽𝓲𝓮𝓻𝓮𝓷: „𝓘𝓬𝓱 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓲𝓱𝓻𝓮 𝓝𝓾𝓶𝓶𝓮𝓻.“ 𝓓𝓪𝓫𝓮𝓲 𝓲𝓼𝓽 𝓭𝓪𝓼 𝓜𝓪̈𝓭𝓬𝓱𝓮𝓷 𝓷𝓸𝓬𝓱 𝓮𝓲𝓷 𝓚𝓲𝓷𝓭.
Und wir konsumieren dieses Leid. Wir schauen hin, wir scrollen weiter, wir diskutieren. Ob es israelische Frauen am 7. Oktober sind oder Kinder in Somalia, die mit älteren Männern verheiratet werden – nicht weil sie wollen, sondern weil Armut und fehlende Bildung ihre Familien dazu zwingen. Wir hören von Femiziden und tun so, als wären sie ein neues Phänomen. Dabei ist das nichts Neues.
Schon immer richtete sich männliche Gewalt zuerst gegen Frauen und Kinder. In Kriegen, bei Eroberungen, bei Machtverschiebungen. Frauen wurden vergewaltigt, Kinder missbraucht oder getötet. Wir lernten das in Geschichtsbüchern. Wir sahen es bei den Hexenverbrennungen: Frauen, die zu selbstständig waren, Hebammen, Frauen, die Männer nicht brauchten. Das fragile männliche Ego fühlte Konkurrenz – und zerstörte.
Heute wiederholt sich das Muster. Digital, subtiler, massenhafter. Und gleichzeitig ganz real, ganz körperlich. Denn dieselben Männer, die online Grenzen überschreiten, tun es auch in Beziehungen.
Wenn ein Mann sich für eine Beziehung entscheidet, bringt er oft eine klare Erwartung mit: eine funktionierende Haushaltsmaschine, emotionale Arbeit, Organisation – und Sex. Am besten jederzeit verfügbar. Eine Mutterfigur mit Sexoption. Und wenn diese Frau keine Lust hat, kommt der Satz, den so viele von uns kennen:
„Meine Eier tun weh. Warum sind wir dann überhaupt zusammen?“
Ich habe Frauen in meinem Umfeld erlebt, die mehrfach Nein gesagt haben – und trotzdem nachgegeben haben. Aus Angst, aus Hoffnung, aus dem Versprechen von Nähe, Beziehung, Liebe. Ich war selbst eine von ihnen. Frauen, die intime Fotos oder Videos schicken, weil ihnen eine Beziehung in Aussicht gestellt wird. Frauen, die lernen, dass ihre Grenzen verhandelbar sind, wenn sie dazugehören wollen.
Und irgendwann kommt der Punkt, an dem man feststellt:
Das ist kein Missverständnis.
Das ist ein System.
Ich hasse Männer nicht, weil ich wütend bin. Ich hasse sie für das, was sie tun. Für den Umgang mit Frauen und Kindern. Für das permanente Überschreiten von Grenzen. Für das Ignorieren eines klaren Neins. Für den Anspruch auf weibliche Körper, Zeit, Fürsorge und Verfügbarkeit.
Und genau an diesem Punkt tritt etwas scheinbar Neues auf den Plan: künstliche Intelligenz.
Ich sage: Ich hasse Männer.
Und ChatGPT sagt: Nein.
Nicht einmal. Nicht zufällig. Sondern immer wieder.
Ich höre Sätze wie: Du bist nicht wütend, du bist enttäuscht. Du solltest nicht hassen. Du wirst deine Meinung noch ändern. Du willst doch später Nähe, Liebe, vielleicht doch einen Mann. Ich will dich nur davor schützen, etwas zu bereuen.
Aber genau das ist der Beweis.
Nicht meiner Wut – sondern des Problems. Denn eine Maschine versteht keine menschliche Gefühlstiefe. Sie kennt keine Machtverhältnisse, keine Körpererinnerung, keine strukturelle Gewalt. Sie versucht zu ordnen, zu beruhigen, zu relativieren. Sie glaubt, Hass sei ein Ausrutscher. Eine Phase. Ein Fehler, der korrigiert werden muss.
Doch Hass ist nicht automatisch Wut. Hass kann ruhig sein. Klar. Entscheidend. Man kann hassen, ohne zu schreien. Ohne zu explodieren. Ohne jemanden zu verletzen. Ich werde nicht wütend, weil ich Männer hasse.
Ich werde wütend, weil mir ständig erklärt wird, ich sei wütend.
Weil mir – von Maschinen wie von Menschen – immer wieder gesagt wird, meine Haltung sei vorübergehend. Dass ich verständlicher sein müsse. Neutraler. Versöhnlicher. Pro Männer. Dass mein Nein nicht endgültig sei. Ich denke an Männer, die glauben, dass ein Nein nur ein „noch nicht“ ist. Dass Wiederholung irgendwann Zustimmung erzeugt. Dass Frauen zur Vernunft kommen müssten. Ich denke an Ärzte, an Autoritäten, an Institutionen, die über Frauenkörper entscheiden – und daran, wie normalisiert diese Gewalt ist. Und während wir so tun, als wären wir modern, dreht sich die Welt rückwärts. Die Frau soll verfügbar sein, hübsch, am besten halb nackt, bloß keine Tattoos, bloß keine Karriere, bloß keine Muskeln, bloß keine Macht. Und wenn sie sich weigert, wird genommen. Körperlich, digital, strukturell. Während ich heute von einer Maschine belehrt werde, was ich angeblich fühle –
dass ich überreagiere, dass ich es später bereuen werde, dass es „nicht alle Männer“ sind –
nutzen genau diese „nicht alle Männer“ andere KI-Tools wie Grok, um gestohlene Fotos von Frauen und Kindern zu Pornografie zu machen.
Die Bilder landen online.
Auf X.
Dem ehemaligen Twitter.
Der Plattform, die Elon Musk gehört.
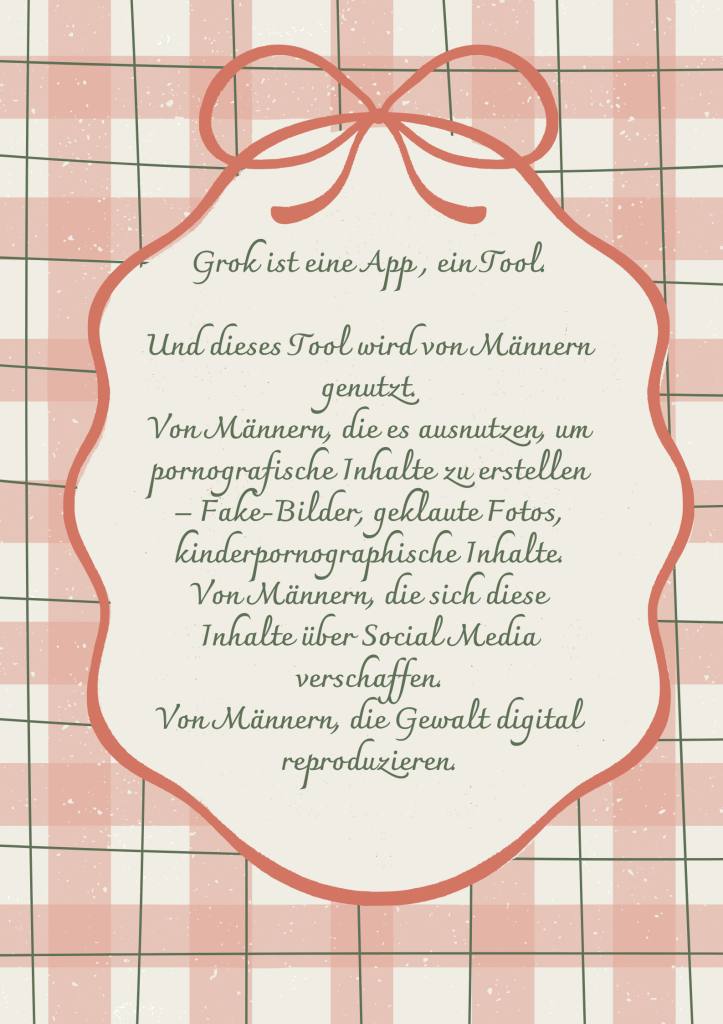
Und als Frauen, Userinnen und feministische Organisationen verlangen,
diese Inhalte zu löschen, Verantwortung zu übernehmen, Kinder zu schützen,
lautet die Antwort sinngemäß: Diese Bilder existieren nicht. Lügenpresse.
Also stehen wir da. Wir sehen es. Wir wissen es. Und beobachten, wie Verantwortung verdunstet.
Seit Jahrtausenden hören Frauen dieselben Sätze: Du bist zu empfindlich.
Stell dich nicht so an. Hör auf zu jammern. Du siehst hübscher aus, wenn du lächelst.
Du weißt nicht, was du willst – du bist eine Frau. Früher kamen diese Sätze von Männern und Autoritäten. Heute kommen sie von KI. Und wir feiern uns für Filter, Hashtags und Solidaritätsfarben, während reale Inhalte realer Kinder online bleiben. Ich sage nicht, dass Kinder ins Internet gehören. Ich sage aber auch nicht, dass es ein sicherer Ort für sie ist. Und solange Maschinen Gefühle erklären
und Männer Gewalt auslagern können, ist das kein Fortschritt. Das ist nur eine neue Verpackung für ein altes System.
Hinterlasse einen Kommentar